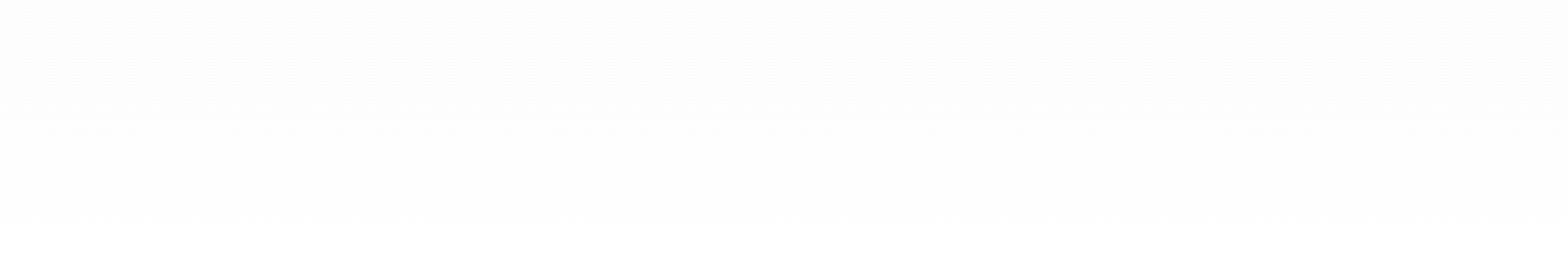AiB plus
Juni 2013
Klinik-Privatisierungen: Ohne Rücksicht auf Verluste
Von Gesa Coordes
1000 Entlassungen wegen eines Streiks, immer mehr Burn-out-Fälle in den Krankenhäusern und sinkende Löhne bei den Service-Kräften: Mit der wachsenden Zahl von Klinik-Privatisierungen steigt der Druck auf die Beschäftigten. Schließlich sollen sie noch Rendite erwirtschaften.
Die Privatisierung von Krankenhäusern ist ein Phänomen aus Deutschland. Selbst in den USA sind nicht annähernd so viele Kliniken privatisiert worden wie hier. „In den meisten Ländern wird die Krankenhausversorgung als Non-Profit-Aufgabe verstanden. Bei uns wurde der Neoliberalismus auf den Gesundheitssektor ausgedehnt“, sagt Niko Stumpfögger, Bundesfachbereichsleiter Gesundheit bei ver.di. Heute gehört jede dritte deutsche Klinik einem privaten Investor – meist einer der großen Ketten. Jedes Jahr werden es mehr.
Der Siegeszug der Privaten begann in den 90er Jahren: Zunächst vor allem in Ostdeutschland, wo die Wertschätzung für die Polikliniken der alten DDR nach dem Fall der Mauer gering war. Es folgten kleine kommunale Häuser sowie Psychiatrien und Spezialkliniken – etwa für Hüft- und Kniegelenksoperationen, mit denen sich gut Geld verdienen lässt. Jetzt sind die großen Krankenhäuser an der Reihe.
Anlass für den Verkauf der Kliniken ist fast immer eine Notlage bei den Investitionen. Um rentabel zu werden, müsste in den öffentlichen Krankenhäusern viel modernisiert und neu gebaut werden. Doch der Staat hat sich schon vor Jahren massiv aus der Förderung der Krankenhäuser zurückgezogen, und die überschuldeten Städte und Gemeinden können das nicht ausgleichen. Die Folge: „Fast allen öffentlichen Kliniken steht das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern schon oberhalb der Nasenspitze“, formuliert der hessische verdi-Gesundheitsexperte Georg Schulze-Ziehaus.
Investitionen können private Anbieter schneller und leichter stemmen. Zudem kommt ihnen das System der Fallpauschalen entgegen. Und sie bekommen die Kliniken in dieser Notlage fast immer viel zu billig. So wurden die nordhessischen Schwalm-Eder-Kliniken Ende 2006 für gerade einmal einen Euro an Asklepios verkauft. Der von SPD, FWG und FDP regierte Kreis wollte damit seine drei defizitären Krankenhäuser loswerden. Doch er erließ der Klinik Schulden in Höhe von 15 Millionen Euro. Und der Kreis zahlte auch nach der Übernahme noch Millionen, berichtet Betriebsratsvorsitzender Klaus Bölling. Sein Fazit: „Mit dem Geld hätten wir das Krankenhaus auch so sanieren können.“ Drei Jahre nach der Privatisierung schloss Asklepios die Klinik am Standort Homberg-Efze. Von den einst 900 Mitarbeitern in der Schwalm gibt es heute nur noch 600. Und die bekommen bis zu 20 Prozent weniger Gehalt als anderswo.
Weil noch Rendite erwirtschaftet werden muss, erhöht sich der Druck auf die Mitarbeiter in fast allen privatisierten Kliniken, weiß Stumpfögger. Die Wege dazu sind unterschiedlich: Meist durch Fluktuation wird die Zahl der Beschäftigten gesenkt. Vor allem Ärzte und Pflegekräfte müssen mehr Kranke betreuen, so dass ihre Arbeitsbelastung steigt. Das zeigt sich auch daran, dass es besonders viele Burn-out-Fälle beim Krankenhauspersonal gibt, so Stumpfögger: „Die Arbeitsverdichtung ist krank machend.“ Es werden vermehrt billigere Hilfekräfte eingestellt. Und es werden ganze Bereiche wie Wäschereien, Küche, Fahrdienst, Reinigung, Physiotherapie und Logopädie ausgegliedert.
Dass die Bürger an vielen Orten massiv für ihre Kliniken kämpfen, nützt oft nur wenig. So wurde Hamburgs Landesbetrieb Krankenhäuser trotz eines erfolgreichen Bürgerbegehrens privatisiert. Um den Verkauf an Asklepios zu verhindern, initiierten Gewerkschaften und Organisationen die Kampagne „Gesundheit ist keine Ware“. Beim Volksentscheid im Februar 2004 stimmten mehr als drei Viertel der Wähler gegen den Verkauf an die Kette. Doch die am gleichen Tag wieder gewählte konservative Regierung folgte dem klaren Votum nicht und verkaufte ihre heute sieben Kliniken, in denen einschließlich Tochtergesellschaften 12 000 Menschen arbeiten. Rechtlich verbindlich war der Volksentscheid nämlich nicht.
Verkauft wurde dann „für einen Appel und ein Ei“, so die Betriebsratsvorsitzende der heutigen Asklepios-Kliniken Hamburg, Katharina Ries-Heidtke. Der Kaufpreis betrug zwar 319 Millionen Euro. Direkt vom Investor an die Stadt gezahlt wurden allerdings nur 19,2 Millionen Euro. Stattdessen übernahm Hamburg ausgerechnet die alten Pensionslasten für die Beschäftigten, an denen das Landeskrankenhaus gescheitert war – Asklepios bekam den bereinigten Betrieb. „Ohne die Pensionslasten hätte der Landesbetrieb das auch schaffen können“, sagt Ries-Heidtke. Stattdessen überwies der Stadtstaat Kompensationszahlungen in Höhe von 77,2 Millionen Euro an das Unternehmen, weil die Ertragslage des Unternehmens den vertraglich garantierten Umsätzen nicht entsprach.
Dazu gab es noch den „bequemsten Personalabbau, den man sich vorstellen kann“, so Ries-Heidtke. Hamburg musste nämlich auch noch für knapp 2000 Klinikmitarbeiter zahlen, die zum Land zurückkehrten. „Letztlich ging mehr Geld von der Stadt an den Investor als umgekehrt“, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Indes hat der Konzern mit den Hamburger Krankenhäusern in den vergangenen drei Jahren gutes Geld verdient. Allerdings klagen die Beschäftigten, dass sich ihre Arbeitsbedingungen vor allem durch die gestiegene Zahl von Patienten dramatisch verschlechtert haben. Zudem gibt es drei konzerneigene Leiharbeitsfirmen. Immerhin schaffte es die Gewerkschaft nach zehn Warnstreiks und 18 Monate dauernden Verhandlungen, einen Tarifvertrag abzuschließen, der sich am TvöD orientiert. Auch die Zahl der Leiharbeiter wurde begrenzt.
Erst vor einem Jahr wurden die Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden an Betreiber Rhön verkauft. Daraufhin sank die Zahl der Mitarbeiter der Service-Gesellschaft von knapp 600 auf gut 400. Frei werdende Stellen werden mit Leiharbeitern besetzt, die bis zu 20 Prozent billiger sind. Die Betriebsratsvorsitzende der HSK Service Christina Köhn berichtet, dass sie noch nie so viele Tränen, Verunsicherung, Demoralisierung und Angst gesehen habe wie in dieser Zeit.
Zu trauriger Berühmtheit haben es die norddeutschen Damp-Kliniken gebracht, zu denen elf Häuser mit 5600 Beschäftigten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehören. Nach dem Verkauf der Damp-Kliniken an den Gesundheitskonzern Helios-Fresenius Ende 2011 kam es zu erbitterten Tarifauseinandersetzungen. Einen Streik nahm Helios zum Anlass, um im Sommer letzten Jahres sage und schreibe 1000 Mitarbeitern der Zentralen Service Gesellschaft (ZSG) der Damp-Kliniken eine Kündigung im blümchenverzierten Umschlag zu schicken. „Sure we can“, versicherte Helios im Kündigungsschreiben, das auch an Schwangere, Ausbildende und Betriebsräte ging. Sie konnten nicht. Nach Massenklagen musste Helios einen Monat später die rechtswidrigen Kündigungen zurücknehmen und einigte sich auf einen Tarifvertrag mit ver.di.
Aus Solidarität mit den unrechtmäßig Gefeuerten waren 3500 Menschen in Kiel auf die Straße gegangen. „Dass in einer Tarifrunde 1000 Leute rausgeflogen sind, hat es bis dahin noch nie gegeben“, kommentiert Bundes-Tarifsekretär Oliver Dilcher. Diese Aggressivität und Rücksichtslosigkeit sei in der Gesundheitsbranche neu. Er erklärt sich das Vorgehen mit den hohen Renditewünschen von Helios.
Doch der Erfolg der Service-Mitarbeiter, zu denen Reinigungskräfte, Küchenpersonal und Fahrer zählen, hielt nicht lange an. Schon im Herbst 2012 wurde die ZSG komplett zerschlagen und in mehrere Firmen aufgegliedert. Ein Betriebsrat existiert inzwischen nur noch in einer der zahlreichen Service-Gesellschaften. Der Rat der Konzern-Betriebsratsvorsitzenden der Damp-Kliniken, Elke Lunkeit: „Man muss sich qualifizieren und höllisch aufpassen, dass das Betriebsverfassungsgesetz eingehalten wird.“ Und die Betriebsräte müssten natürlich gewerkschaftlich organisiert sein.
Um grundsätzlich etwas zu verändern, braucht es verbindliche Personalmindeststandards in den Kliniken und mehr Investitionen. Das würde auch den öffentlichen Häusern helfen, in denen die Arbeitsbedingungen oft kaum besser sind. Für eine gute Versorgung der Patienten in Krankenhäusern fehlen nach einer aktuellen Erhebung von ver.di bundesweit etwa 162000 Vollzeitstellen, davon etwa 70000 in der Pflege. „Wenn wir es schaffen, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, wäre das Problem der Privatisierung nicht mehr so groß wie im Augenblick“, sagt Schulze-Ziehaus. Er empfiehlt zudem Holding-Strukturen und Kooperationen von kommunalen Krankenhäusern, um ihr Überleben zu sichern.
Nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers und der verdi-Kampagne „Der Deckel muss weg“ ging der Privatisierungs-Optimismus verloren, sagt Niko Stumpfögger. Es gab ein Investitionsprogramm für Krankenhäuser, deren Finanzierung gestärkt wurde. Die Privatisierungswelle wurde gebremst. Doch mit der Not der Kommunen nimmt der Druck wieder zu. Dabei lassen sich noch nicht einmal alle Kliniken verkaufen. Es werde auch eine Welle von Klinik-Schließungen geben, prognostiziert Schulze-Ziehaus.
Einen Vorteil für die Gewerkschaften haben die Entwicklungen: Die Zahl der Mitglieder im Gesundheitsbereich von ver.di steigt stetig. Das gilt vor allem für die privatisierten Krankenhäuser: So kletterte die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder an der Uni-Klinik Gießen und Marburg von noch nicht einmal 1000 Mitgliedern auf mehr als 1500, bei den Horst-Schmidt-Kliniken gab es eine Steigerung um mehr als 60 Prozent. „So schlimm wie das ist“, sagt Verdi-Gesundheitsexperte Georg Schulze-Ziehaus: „Die Privaten sind unser bestes Werbemittel.“